Kurzbericht
Ursachen unterschiedlicher
Kostendeckungsgrade im ÖPNV
mittlerer Städte
Forschungsprogramm
"Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in
den Gemeinden 1998 (FOPS 1998)"
Einzelprojekt 70.544/98
Arbeitsgemeinschaft:
Planungsbüro VIA eG, Köln
IFB Institut für Bahntechnik GmbH, Köln
| |
| Untersuchungs- gegenstand | Untersuchungsgegenstand des Forschungsprojektes ist es, einen Erklärungsansatz für die Ursachen unterschiedlicher Kostendeckungsgrade im ÖPNV mittlerer Städte zu entwickeln. Der Begriff des Kostendeckungsgrads wird in der Regel unter betriebswirtschaftlicher Sichtweise und unter Bezugnahme auf die von den Verkehrsunternehmen publizierten Werte gefaßt. Unternehmensvergleiche im Hinblick auf die Kostendeckungsgrade sind jedoch problematisch, da zum einen aus den publizierten Daten nicht ersichtlich ist, welche Einflußgrößen wie in die Berechnung einfließen bzw. welche Größen unberücksichtigt bleiben. In den meisten Fällen handelt es sich um eine reduzierte Betrachtung von betriebswirtschaftlichen Unternehmenskennziffern. |
| Untersuchungs- ansatz | Was bislang fehlt, ist die Aufarbeitung der Rahmenbedingungen, unter denen ÖPNV-Dienstleistungen erbracht werden. Das Forschungsprojekt hat zum einen den Schwerpunkt, die Datenlage in den deutschen Mittelstädten im Hinblick auf Nachvollziehbarkeit und Bewertung des Kostendeckungsgrades des innerstädtischen Busverkehrs zu klären, zum anderen soll, abhängig von den verfügbaren Daten, der Einfluß der Rahmenbedingungen auf den Kostendeckungsgrad analysiert werden. Daraus sollen Empfehlungen für die Kommunen abgeleitet werden. |
| Schwerpunkte der Untersuchung | Das Projekt umfaßt zwei Teile: eine empirische Städteuntersuchung und eine vertiefende Untersuchung anhand der fünf Beispielstädte Brühl/Rheinland, Dormagen, Eisenhüttenstadt, Villingen-Schwenningen und Völklingen. Die empirische Untersuchung konzentrierte sich auf Städte mit Stadtbusverkehr, d.h. solche, in denen eine Buslinie nur innerhalb der Stadtgrenzen verkehrt und nicht ausschließlich dem Schülerverkehr nach § 43 PBefG dient. Die Untersuchung soll den Kenntnisstand der Kommunalvertreter in bezug auf die Aspekte, die mit dem Kostendeckungsgrad zusammenhängen, ermitteln. Die Städte der vertiefenden Untersuchung verfügen über eigenständige Stadtbussysteme bzw. über einen Stadtverkehr, dessen betriebliche und ökonomische Kennziffern sich gemeindegrenzenscharf darstellen lassen. Es handelt sich sowohl um moderne als auch um traditionelle Stadtverkehre mit jeweils verschiedenartigen geografischen, betrieblichen und zum Teil auch organisatorischen Rahmenbedingungen. Nach Auswertung der verfügbaren Daten wurde der Schwerpunkt der vertiefenden Städteuntersuchung auf die raumbezogenen Faktoren gelegt, die die Rahmenbedingungen des Kostendeckungsgrads beeinflussen. |
| UNTERSUCHUNGSMETHODEN BEI DER EMPIRISCHEN STÄDTEBEFRAGUNG
| |
| Ziel und Gegenstand der Befragung | Ziel der Städtebefragung ist es, herauszufinden, inwieweit die Ermittlung des Kostendeckungsgrads in deutschen Mittelstädten möglich ist und Kosten-/Erlösstrukturen stadtgrenzenscharf abgebildet werden können. Erfaßt werden Angebot und Nachfrage sowie Organisations- und Finanzierungsstrukturen für den innerstädtischen Busverkehr. Erhoben werden weiterhin die Kenntnis des jeweiligen Kostendeckungsgrads sowie die Bestimmungsparameter, die in diesen hineinfließen bzw. die nach Ansicht der Städte zu berücksichtigen wären. Bezugsjahr der angefragten Daten ist das Jahr 1997. |
| Stichprobe, Rücklauf, Auswertung | Insgesamt wurden alle 304 bundesdeutschen Mittelstädte zwischen 30-100.000 Einwohner mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens, der postalisch versandt wurde, befragt. Der Rücklauf von 161 Fragebögen (Rücklaufquote: 53 % der versandten Fragebögen) wurde quantitativ mit dem Daten-analyseprogramm SPSS (Superior Performing Software Systems) ausgewertet. Zahlreichen Rücksendungen gingen telefonische Anfragen von Seiten der befragten Städte voraus. Die hohe Rücklaufquote kann als Hinweis darauf gedeutet werden, daß die Kostendeckung im ÖPNV in vielen Kommunen ein wichtiges Thema ist. |
| UNTERSUCHUNGSMETHODEN BEI DER VERTIEFENDEN STÄDTEUNTERSUCHUNG
| |
| In den fünf Beispielstädten erfolgte eine Auswertung der zugänglichen betrieblichen und ökonomischen Daten der Verkehrsunternehmen. Datengrundlage waren Fahrpläne, Geschäftsberichte, Nahverkehrspläne und ÖPNV-relevante Untersuchungen. Gesprächspartner waren die für den ÖPNV Zuständigen in den Stadtverwaltungen und leitende Mitarbeiter in den Verkehrsunternehmen. | |
| indexgestützte Bewertungsmethode | Zur Ermittlung der räumlichen Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des Stadtbusverkehrs wurde eine indexgestützte Bewertungsmethode entwickelt, die auch auf andere Städte übertragbar ist. Das Bewertungsmodell umfaßt folgende aufwands- und nachfragerelevante Größen: |
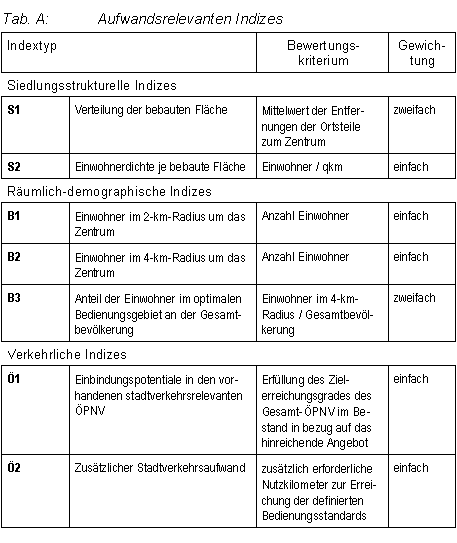
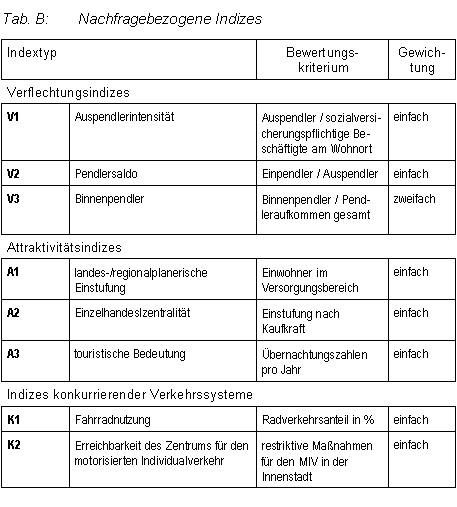
Für die fünf Untersuchungsstädte werden auf der Grundlage der Ausprägung der einzelnen Indikatoren mit Hilfe einer fünfstufigen Bewertungsskala insgesamt 15 Indizes gebildet. Die beiden Indextypen bilden jeweils zusammenfassende Werte, die dann gegenüberzustellen und zu interpretieren sind.
| zentrale Forschungs- hypothese | Um den Einfluß der Raumstruktur auf den Betriebsaufwand zu bewerten, wurde eine zentrale Forschungshypothese aufgestellt und an den Beispielstädten überprüft. Die Hypothese lautet, daß die verschiedenen Städte mit ihren unterschiedlichen Raum- und Siedlungsstrukturen jeweils einen unterschiedlichen Aufwand betreiben müssen, um dieselbe Bedienungsqualität im ÖPNV anbieten zu können. In bezug auf den Kostendeckungsgrad bedeutet dies, daß die Raumstruktur einen wesentlichen Einfluß auf die Effizienz der einzelnen Stadtverkehrsnetze hat. Die Überprüfung der Hypothese eröffnet einen neuen Blickwinkel in die üblicherweise vorwiegend vor betriebswirtschaftlichem Hintergrund geführten Diskussionen um den Kostendeckungsgrad. |
| standardbezogene Bewertung | Die Stadtbusnetze wurden einem Soll/Ist-Vergleich im Hinblick auf folgende Qualitätsstandards unterzogen und überprüft:
Der zu ermittelnde Zusatzaufwand, der auch der Berechnung von Index Ö2 zugrundeliegt, ist der Nutzkilometeraufwand, der zur Erreichung von mindestens 80% der Bevölkerung unter oben genannten Bedienungsstandards erforderlich ist. Bei seiner Ermittlung werden örtlich angepaßte Maßnahmen zur Erfüllung der Standards entwickelt und der erforderliche Aufwand bewertet. |
| kommunale Kosten des ÖPNV | Für die Untersuchung der kommunalen Kosten des ÖPNV dienten die Haushaltspläne als Grundlage. Zur Betrachtung des kommunalen Aufwandes für die Erbringung von ÖPNV-Leistungen werden die Rechtsgrundlagen dargestellt, insofern sie die Schwierigkeiten der Kommunen erklären, um die Kosten des ÖPNV zu benennen. Diese Grundvoraussetzungen, in denen sich die handelnden Kommunen bewegen, werden im Zusammenhang diskutiert und bewertet. In einem weiteren Schritt wurden die Haushaltspläne der an der vertiefenden Untersuchung teilnehmenden fünf Städte im Hinblick auf stadtverkehrsrelevante Haushaltsstellen ausgewertet. Ziel dieses Teils der Untersuchung ist die Entwicklung eines Kataloges wichtiger zu berücksichtigender Haushaltsposten, um sich dem kommunalen Kostendeckungsgrad zu nähern. |
ERGEBNISSE DER EMPIRISCHEN STÄDTEBEFRAGUNG | |
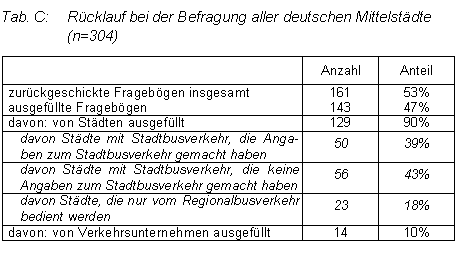
Es stellte sich jedoch heraus, daß den Kommunen kaum ökonomische Daten für den Stadtbusverkehr bekannt sind. Empirisch wird gezeigt, daß ein Zusammenhang zwischen ÖPNV-Angebot und Nachfrage besteht und daß dieser von raumstrukturellen Faktoren beeinflußt wird. | |
| ausgewählte Ergebnisse
| Die Zuständigkeiten im Aufgabenbereich ÖPNV sind in der städtischen Verwaltung äußerst heterogen. Dies zeigt einerseits, daß der ÖPNV eine breit angelegte Querschnittsaufgabe ist, andererseits, daß sich das kommunale Engagement vielfach auf eine nur rahmengebende Funktion beschränkt. An den Zuständigkeiten zu den einzelnen Aufgabenteilbereichen im ÖPNV läßt sich das Subsidaritätsprinzip erkennen: Die jeweils höheren oder übergeordneten Verwaltungsebenen füllen diejenigen Aufgabenbereiche aus, die von den unteren (in diesem Fall den Kommunen) nicht (effektiv) geleistet werden können. Die von einigen Städten ausschließlich angegebene Zuständigkeit der Verkehrsunternehmen muß unter historischen Gesichtspunkten interpretiert werden. Die "Allzuständigkeit" der Unternehmen läßt sich noch in vielen Fällen feststellen, insbesondere, wenn es sich um kommunale Unternehmen handelt oder um solche, die keine oder kaum kommunale Zuwendungen erhalten. In solchen Strukturen haben die Kommunen ihre Regiefunktion für den Stadtverkehr noch nicht wahrgenommen, da zur Zeit noch kein Handlungs- und Veränderungsbedarf besteht. Die vielfältigen Zuständigkeiten für den ÖPNV machen es sehr schwer, die Kostendeckungsgrade der verschiedenen Stadtverkehrssysteme nachzuvollziehen und zu vergleichen. Insbesondere unterschiedliche Aufgabenverteilungen zwischen Stadt und Verkehrsunternehmen erschweren eindeutige Angaben zu den einzelnen Kostenblöcken. So entstehen zum Beispiel Marketing- und Mobilitätsberatungskosten zum Teil bei den Verkehrsunternehmen, zum Teil aber auch ausschließlich bei den Kommunen, und dort sind sie mitunter in den Haushaltsstellen nicht sofort identifizierbar. Häufig sind auch Mischformen anzutreffen. Die auf der kommunalen und der unternehmerischen Seite entstehenden Kosten werden in der Regel nicht zusammengeführt. Daher ist es wichtig, Indikatoren für ein einheitliches Kostenstellenerhebungsdesign zu entwickeln und bei der Betrachtung einzelner Stadtverkehrsunternehmen anzuwenden. |
| Angebot, Betriebsleistung, Nachfrage | Vor allem für Städte bis 60.000 Einwohner ergibt sich ein relativ klarer Zusammenhang zwischen Stadtgröße und Betriebsleistung bzw. Nachfrage. Der stärkste Zusammenhang besteht zwischen Fahrgastaufkommen und Betriebsleistung. Die hieraus abzuleitende Aussage, daß kompakte Siedlungsstrukturen effizienter vom ÖPNV zu bedienen sind als mehrkernige und somit tendenziell ein höherer Kostendeckungsgrad zu erwarten ist, darf jedoch nicht monokausal interpretiert werden. Weitere Qualitätsaspekte, die hier keinen Eingang in das Modell finden konnten (zum Beispiel Vertaktung, Fahrzeugmaterial, Marketing), müssen hier unbedingt berücksichtigt werden. |
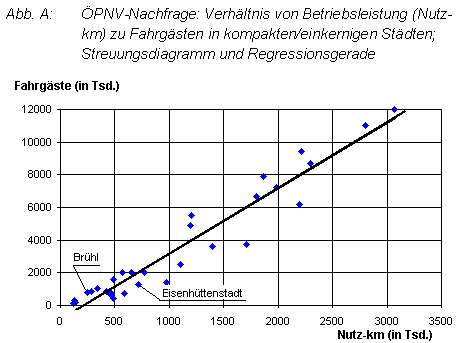
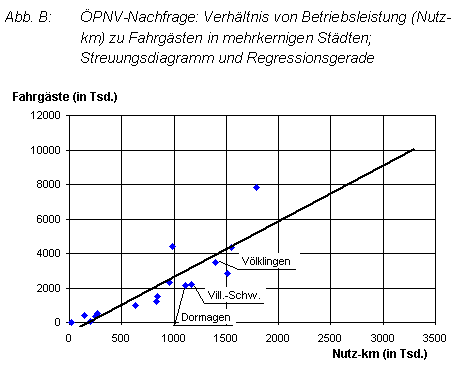
| Verhältnis Fahrgäste zu Betriebsleistung | Als Durchschnittswert ergibt sich für kompakte/einkernige Städte ein Fahrgastaufkommen, das etwa dem 2,7-fachen der Betriebsleistung entspricht, bei mehrkernigen Städten liegt der Faktor bei rund 2,1. Eine bestimmte Nachfrage läßt sich also in kompakten Städten mit einem geringeren betriebswirtschaftlichen Aufwand erreichen als in mehrkernigen Städten. |
| Kostendeckungsgrade | Kostendeckungsgrade sind bei den wenigsten der befragten Städte bekannt, deren Definition noch weniger. Es besteht große Unsicherheit, welche Kosten- und Einnahmenpositionen eingerechnet werden. Somit wird deutlich, daß betriebliche Kostendeckungsgrade, die von den Unternehmen errechnet werden, weder überprüft noch hinterfragt werden können, da in den meisten Fällen in den Verwaltungen weder Kenntnisse noch Daten vorhanden sind. Vor diesem Hintergrund kann es durchaus bedenklich stimmen, daß mit der Angabe von Werten zum Kostendeckungsgrad üblicherweise im politischen Raum argumentiert wird, ohne jedoch Vergleichsgrundlagen zu kennen bzw. sich der erörterten Problematik bewußt zu sein. |
| Organisations- und Finanzierungsfomen | Die Befragung hat ergeben, daß es keine Standardform der Organisation von Stadtbussystemen gibt. Auch sind die Finanzierungswege in den einzelnen Städten recht variabel. Aussagen, die Schlüsse von Organisations- und Finanzierungsformen auf den Kostendeckungsgrad zulassen, konnten nicht empirisch belegt werden. Organisations- und Finanzierungsformen basieren größtenteils auf der Grundlage individueller Entscheidungen der Städte oder sind - vor allem bei vielen traditionellen Stadtverkehrssystemen - historisch gewachsen. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Möglichkeit, aktiv auf den Kostendeckungsgrad einzuwirken, umso größer ist als die Städte ihren Gestaltungsspielraum bei der Planung und Umsetzung des lokalen ÖPNV wahrnehmen. Auch mittlere kreisangehörige Städte können, um diesen Effekt zu erzielen, selbst Aufgabenträger für den ÖPNV werden. Länderspezifische Regelungen sind in den einzelnen ÖPNV-Gesetzen in den jeweiligen Paragraphen zur Aufgabenträgerschaft niedergelegt. |
| ERGEBNISSE DER VERTIEFENDEN STÄDTEUNTERSUCHUNG
| |
| Ein wichtiges Ergebnis der vertiefenden Städteuntersuchung ist, daß die räumlich-geografischen Einflußgrößen auf den erforderlichen ÖPNV-Aufwand quantifizierbar sind. Der räumliche Aspekt hat hingegen bei der Bewertung der Effizienz des ÖPNV sowohl bei den Kommunen, als auch bei den Verkehrsunternehmen zur Zeit noch keinerlei Bedeutung. Auch wenn sich keine quantitativen Aussagen über die genaue Auswirkung der jeweiligen Raumstrukturen auf den Kostendeckungsgrad darstellen lassen, da die übrigen Parameter des Kostendeckungsgrades die Vergleichbarkeit nach wie vor verzerren, lassen sich Tendenzen beschreiben, die bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Stadtbussystemen zukünftig stärker zu beachten wären. | |
| aufwands- und nachfrageorientierte Faktoren | Da sowohl die aufwands- als auch die nachfrageorientierten Faktoren auf den wirtschaftlichen Betrieb von Stadtverkehrssystemen Einfluß ausüben, werden die aufwandsorientierten sowie die nachfragerelevanten Indizes (vgl. Tab. A und B) der fünf Untersuchungstädte in nachstehender Graphik zusammengeführt. |
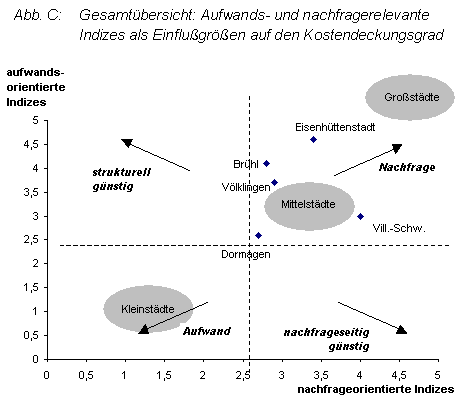
| Auf der x-Achse werden die nachfrageorientierten Indizes aufgetragen. Je höher der Wert, umso stärker wirken die in der Untersuchung ermittelten raumstrukturell unabhängigen Nachfragefaktoren. Die y-Achse enthält die zusammengefaßten Werte, die die untersuchten raumstrukturellen Größen beschrieben. Je höher dieser Wert, umso weniger Nutzkilometeraufwand muß in einer Stadt betrieben werden, um eine standardisierte Bedienungsqualität zu erzielen. | |
| Stadtgrößen | Teilt man das von x- und y-Achse beschriebene Feld in vier Quadranten ein, finden sich die untersuchten Mittelstädte im rechten oberen Quadranten wieder. Kleinstädte, bei denen prinzipiell weniger Nachfrage an ÖPNV-Leistungen zu erwarten ist, aber auch weniger Aufwand anfällt, befinden sich tendenziell im linken unteren Quadranten. Großstädte mit starker Nachfrage und großem Nutzkilometeraufwand schließen sich rechts oben an das Feld der Mittelstädte an. |
| Effizienz und Kostendeckungsgrad | Wie die vertiefende Städteuntersuchung gezeigt hat, kann bei kompakten Städten die Nachfrage nach ÖPNV-Dienstleistungen sinken, da hier aufgrund von kurzen Wegen das Fahrradfahren und zu Fuß Gehen attraktiv ist. Am effizientesten sind diejenigen Stadtverkehre, die eine relativ starke Nachfragestruktur unter Begrenzung des Nutzkilometeraufwandes haben. Die Voraussetzungen für eine möglichst effiziente Gestaltung des Stadtverkehrs werden in der Abbildung in den zentralen Bereichen der vier Quadranten dargestellt. Hier ist das Verhältnis von Aufwands- und Nachfragefaktoren am ausgewogensten. |
| Anwendung auf Beispielstädte | Letzteres ist in Eisenhüttenstadt der Fall, da hier eine relativ hohe Zentralität ohne starke Konkurrenz mit Nachbarorten, schlechte Bedingungen zum Fahrradfahren in Verbindung mit einer kompakten Stadtstruktur und einem gut ausgebauten ÖPNV im Bestand vorliegen. Im Vergleich sind die zuletzt genannten Bedingungen in Brühl bei ebenfalls günstiger Siedlungsstruktur ungünstiger. Die stärkste Nachfrage ist in Villingen-Schwennigen vorzufinden, was vor allem in der oberzentralen Bedeutung der Stadt und in der Siedlungsstruktur als Doppelstadt mit längeren Wegen begründet liegt. In Dormagen muß sein sehr hoher Aufwand trotz des gut ausgebauten Stadtbussystems erbracht werden, da die Siedlungsstruktur ungünstig ist. Die Nachfragefaktoren sind ähnlich wie in Brühl oder Völklingen ausgeprägt. Völklingen liegt, was den zu erbringenden Aufwand angeht, im Mittelfeld, da die Stadtstruktur hier Ansätze zu einer Mehrkernigkeit aufweist. |
| KOMMUNALE KOSTEN DES ÖPNV IN MITTELSTÄDTEN
| |
| Die Bewertung des kommunalen Aufwandes für den Stadtbusverkehr wird durch die Vielfalt der unmittelbar und mittelbar ÖPNV-relevanten Haushaltstitel erschwert. Die Auswertung der vorliegenden Haushaltspläne und der Gespräche mit den städtischen Mitarbeitern haben ergeben, daß bei der Darstellung der kommunalen Kosten des ÖPNV mindestens folgende Einzelpläne und Haushaltstitel zu berücksichtigen sind: | |
| EP 6 Bau-, Wohnungswesen, Verkehr | Da sowohl die aufwands- als auch die nachfrageorientierten Faktoren auf den wirtschaftlichen Betrieb von Stadtverkehrssystemen Einfluß ausüben, werden die aufwandsorientierten sowie die nachfragerelevanten Indizes (vgl. Tab. A und B) der fünf Untersuchungstädte in nachstehender Graphik zusammengeführt. |
| EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | Im EP 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung befinden sich im Abschnitt Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr im Unterabschnitt Förderung des Straßenverkehres ÖPNV-relevante Posten. Bei den Einnahmen sind dies neben sogenannten vermischten Einnahmen und Spenden möglicherweise Rückzahlungen von Zuschüssen für den Stadtverkehr (das Stadtverkehrsunternehmen ist unter Umständen verpflichtet, etwaige erhaltene Zuschüsse mit Gewinnen zu verrechnen und an die Kommune zurückzuzahlen). Bei den Ausgaben sind die Gebäudeunterhaltung, beispielsweise von Wartehäuschen, die Posten für Fahrpläne und Öffentlichkeitsarbeit, Prüfungs- und Gutachterkosten, Leistungen des Bauhofes sowie eventuell der Zuschuß für den Stadtverkehr, zum Beispiel bei einer Einführung von neuen Buslinien zu berücksichtigen. |
| EP 8 Wirtschaftsunter- nehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen | Im EP 8 sind die Titel für Wirtschaftsunternehmen und allgemeine Grund- und Sondervermögen aufgeführt. Hier sind die Angaben zu städtischen GmbH zu finden, die stadtverkehrsrelevant sein können, wie beispielsweise die Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH. Unter der Rubrik Einnahmen findet man Angaben zur Gewinnablieferung oder Konzessionsabgabe. |
| EP 0 Hauptamt | Je nach Verwaltungsaufbau können noch weitere Einzelpläne relevante Einzeltitel für den ÖPNV enthalten. Dazu zählen generell die Personalausgaben (Einzelplan 0 Hauptamt), Zuweisungen vom Land oder Raummieten. In jedem Fall ist aber eine Überprüfung der aufgeführten Posten auf ihre tatsächliche Relevanz für den Stadtverkehr unabdingbar. Damit bleibt die Auswertung der kommunalen Kostenstrukturen eine Einzelfalluntersuchung. Die Kommunen können aufbauend auf ihrem Haushalts- und Rechnungswesen ÖPNV-relevante Kriterien ableiten, wenn sie an der Ermittlung des kommunalen Kostendeckungsgrades interessiert sind. Diese wären mit den Angaben zum betriebswirtschaftlichen Kostendeckungsgrad zusammenzuführen. Tabelle D faßt die betriebswirtschaftlichen und kommunalen Aspekte zur Bestimmung und Bewertung von Angaben zum Kostendeckungsgrad zusammen. |
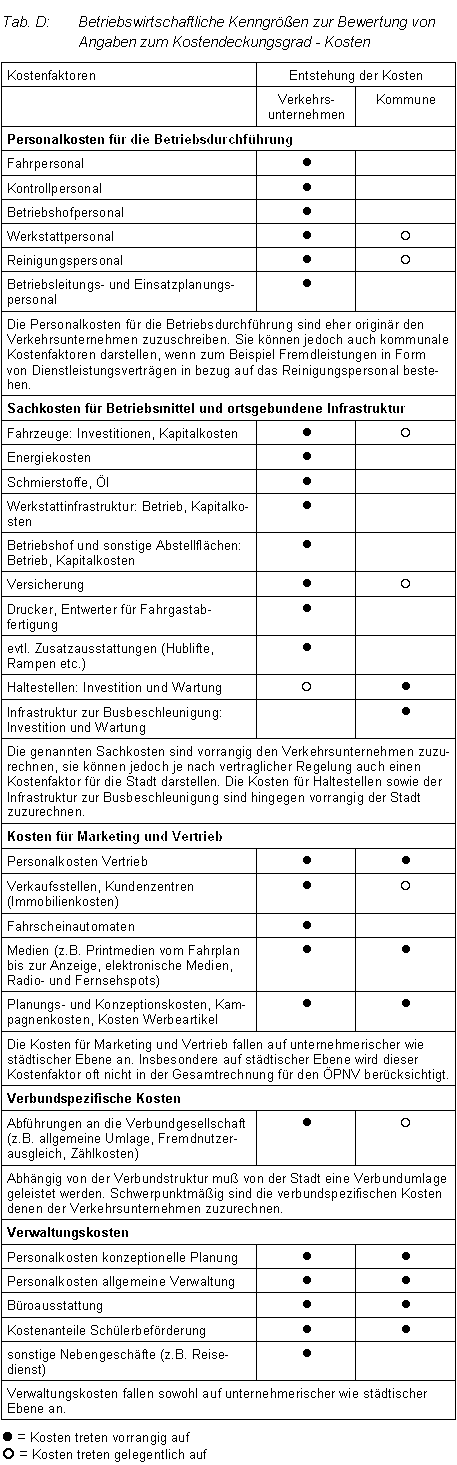
| FOLGERUNGEN FÜR DIE PRAXIS
| |
| Fazit aus den Ergebnissen des Forschungsprojektes ist die Empfehlung, daß für die ökonomische Bewertung von Stadtbusverkehren ein standardisiertes Erhebungs- und Darstellungsverfahren entwickelt werden sollte, in das unter anderem auch raumstrukturelle Faktoren zu integrieren sind. Auch sind klare Kostenstellenrechnungen für sämtliche ÖPNV-relevanten Positionen sowohl bei den Verkehrsunternehmen als auch bei den Kommunen zu fordern. Weiterhin wurde festgestellt, daß für die Kommunen, die sich aktiv um die Gestaltung des städtischen ÖPNV bemühen, eine einheitliche Datengrundlage geschaffen werden muß, die als Bezugsgrundlage für eine interkommunal vergleichbare Aufbereitung von Angaben zum Kostendeckungsgrad verwendet werden kann. Aufgrund der Komplexität dieser Aufgabenstellung ist dieser Aspekt in weitere Teilfragestellungen zu differenzieren, für die wir folgende Aspekte zur weiteren Untersuchung vorschlagen: | |
| Datenerhe- bungsdesign | Entwicklung eines einheitlichen Datenerhebungsdesigns zum Zweck einer regelmäßigen Vollerhebung der relevanten Daten auf einer stadtgrenzenscharfen Betrachtungsebene |
| Indikatoren- entwicklung | Entwicklung von Bewertungsmaßstäben und Standards für Indikatoren, die den Kostendeckungsgrad beschreiben, dessen Entwicklung kennzeichnen und dazu beitragen, Angaben zur Kostendeckung in den verschiedenen Stadtverkehrssystemen vergleichbar zu machen |
| Datenverknüpfung | Überprüfung von Verknüpfungsmöglichkeiten der ÖPNV-Daten mit kontinuierlich erhobenen Raumstrukturdaten |
| Monitoring für den ÖPNV in Mittelstädten | Entwicklung von möglichst flexibel einsetzbaren Verfahren für die laufende Nutzer- und Nachfragebeobachtung (Monitoring kleinerer und mittlerer Stadtverkehrsnetze), da die Fahrgastentwicklung über die Fahrausweisstatistik nicht immer eindeutig nachvollziehbar ist (zum Beispiel in Form von automatischen Fahrgastzählsystemen) |
| Berücksichtigung der Raumstruktur | Diskussion der raumstrukturellen Einflußgrößen auf die Effektivität des Kostendeckungsgrads in den zuständigen Ämtern und Gremien der Stadtverwaltungen und Verkehrsunternehmen, um ein schärferes Bewußtsein für diesen Aspekt zu schaffen, bei dessen Nichtbeachtung bestimmte Kommunen aufgrund ihrer geografischen Voraussetzungen und administrativen Zuschnitte systematisch benachteiligt würden |
| Begriffsklärung | Modifikation der Definition des Begriffs Kostendeckungsgrad unter Berücksichtigung zusätzlicher Einflußgrößen wie beispielsweise systemexterne Nachfragedeterminanten und Raumstruktur |
| Förderpraxis | Diskussion der Förderpraxis in bezug auf den ÖPNV unter Einbeziehung raumstruktureller Aspekte |
| Weiterentwicklung Querverbund | Diskussion, Weiterentwicklung und Überprüfung des Querverbundgedankens unter der EU-Rahmengesetzgebung, insbesondere im Hinblick auf den praktizierten "privaten Querverbund" nichtöffentlicher Unternehmen |
| Die Behandlung dieser vertiefenden Fragestellungen sollte auf verschiedenen Ebenen erfolgen, deren intensive Zusammenarbeit hierbei vorauszusetzten ist. Dies sind zum einen die Verwaltungsebenen der Kommunen und zum anderen die Verkehrsunternehmen bzw. deren Verbände als Praxisanwender sowie der Bund als rahmensetzende Institution. Die Ergebnisse des vorliegenden Forschungsprojektes sowie die Aufarbeitung der beschriebenen noch offenen Fragestellungen können dazu beitragen, die Wettbewerbsbedingungen für den ÖPNV in mittleren Städten zu verbessern und Kommunen wie Verkehrsunternehmen Argumentationshilfen für eine sachgerechte Bewertung der verkehrlich-räumlichen Situation im Hinblick auf deren ökonomische Auswirkungen zu liefern.
| |





